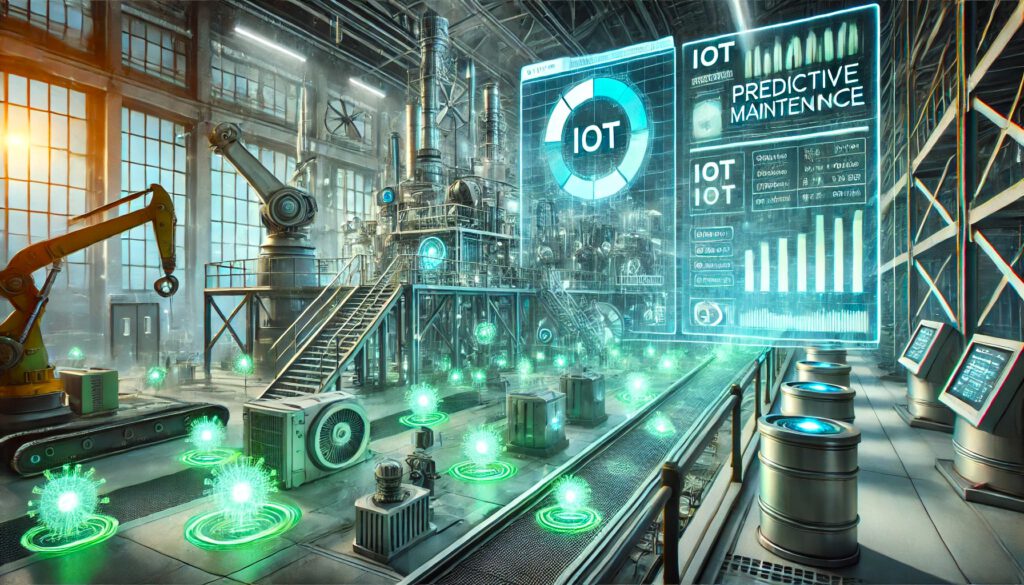
Predictive Maintenance (PdM) ist ein seit Jahren wachsender Trend, der verspricht, das Anlagenmanagement in Unternehmen zu revolutionieren. Von der Reduzierung von Ausfallzeiten bis hin zu Kosteneinsparungen – PdM wird als bahnbrechend angepriesen. Aber ist es wirklich die Investition wert oder nur ein weiterer überbewerteter Trend?
Was ist Predictive Maintenance (PdM)?
Predictive Maintenance nutzt Werkzeuge wie Machine Learning (ML), IoT-Sensoren und Datenanalyse, um Anlagenausfälle vorherzusagen. Im Gegensatz zur vorbeugenden Instandhaltung, die sich auf geplante Wartungsintervalle stützt, werden bei der PdM Echtzeitdaten verwendet, um Anomalien zu erkennen und festzustellen, wann eine Wartung tatsächlich erforderlich ist.
Welche Fallstricke gibt es bei Predictive Maintenance?
Die erste große Hürde besteht darin, einen Anwendungsfall zu identifizieren, in dem Predictive Maintenance eine sinnvolle Lösung darstellt. Handelt es sich um Anlagen, die ständig umgebaut werden und deren Verhalten sich dadurch regelmäßig ändert, macht Predictive Maintenance keinen Sinn. In solchen Fällen müsste das PdM-Modell bei jedem Umbau neu trainiert werden, und das oft mit Daten, die noch gar nicht vorliegen.
Machine Learning (ML) Modelle sind nur so gut wie die Daten, die zum Modelltraining benutzt werden. Häufig werden im industriellen Umfeld, wenn das technische Wissen nicht vorhanden ist, alle verfügbaren Sensordaten in das Modell geworfen. Dies führt oft zu scheinbar guten Ergebnissen, die aber im laufenden Betrieb keinen Mehrwert liefern. Dafür kann es 2 Gründe geben:
- Kausalität: Wenn ein Modell mit vielen Eingangsgrößen trainiert wird, die alle den gleichen Trend aufweisen, werden Kausalitäten nicht richtig abgebildet. Dadurch können Symptome als Einflüsse interpretiert werden und die Aussagekraft des Modells ist nicht mehr gegeben.
- Overfitting: Wie eine Polynomgleichung kann auch ein ML Modell komplexer gestaltet werden, um eine bessere Vorhersage für die vorhandenen Daten treffen zu können. Dies kann aber im Extremfall zu einem Overfitting führen, d.h. das Modell bildet nicht mehr den allgemeinen Trend ab, sondern lernt die Daten sehr gut, um nur noch die Trainingsdaten abzubilden. Dies ist unten dargestellt.
Wie stellen wir bei KDS sicher, dass unsere Modelle robust sind?
- Identifikation der Anwendungsfälle: Als erstes schauen wir gemeinsam, in welchen Fällen PdM wirklich einen Mehrwert bringen kann und wo die Daten vorhanden sind, um ein vernünftiges Modell aufzusetzen. Ein Beispiel: Eine Kreiselpumpe, bei der regelmäßig das Laufrad oder eine andere Komponente ausgetauscht wird, ist kein guter Anwendungsfall für PdM.
- Datenauswahl: Mit unserem verfahrenstechnischen Wissen fließen nur Daten in das Modell ein, die auch einen direkten Einfluss auf den analysierten Prozess haben können. Diese werden in Diskussionen mit Ihnen, dem echten Experten für den Prozess, ermittelt. Um mögliche unbekannte Einflussgrößen zu identifizieren, diskutieren wir in Workshops, welche Informationen auf Basis unseres Fachwissens und Ihrer Erfahrung noch in das Modell aufgenommen werden müssen.
- Validierung des Modells: Unsere Modelle werden explizit auf Overfitting getestet, um die Robustheit auch im laufenden Betrieb zu gewährleisten.
Möchten Sie mit PdM in Ihrem Unternehmen einen Mehrwert erzielen?
Dann kontaktieren Sie uns gerne und wir kommen zu Ihnen vor Ort, um eine detaillierte Bestandsaufnahme durchzuführen.
